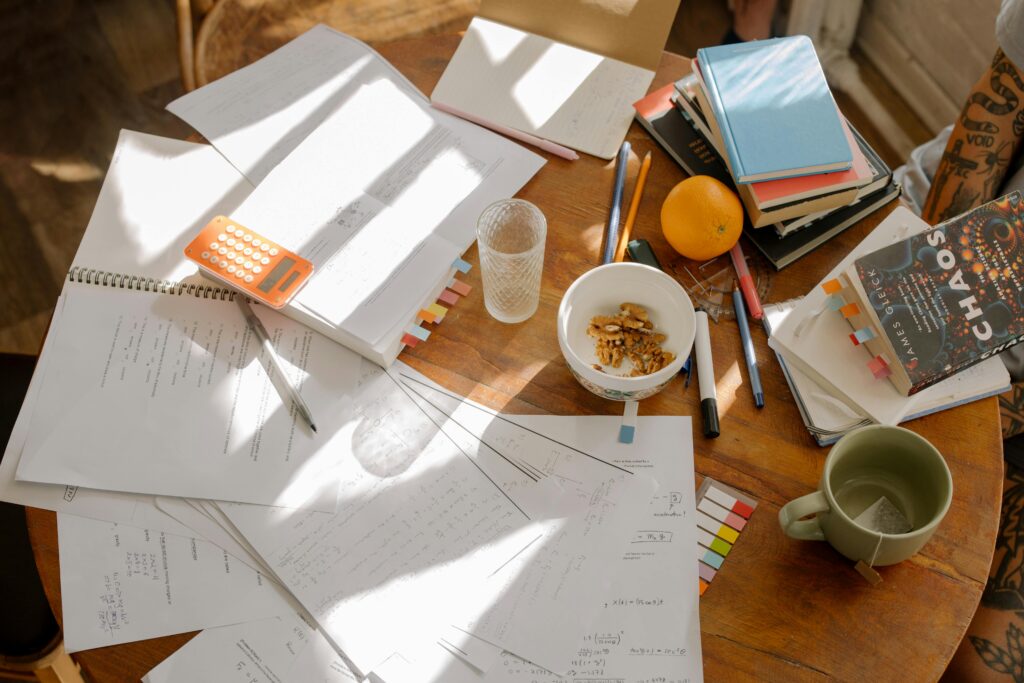
ADHS: Praktische Einblicke und professionelle Tipps
ADHS – diese Abkürzung kennst du vielleicht aus Erzählungen über Kinder, die „nicht stillsitzen können“. Aber was steckt wirklich dahinter? ADHS betrifft erwachsene Menschen genauso, nur die Symptome zeigen sich oft anders und werden leicht übersehen. In der therapeutischen Praxis begegnet mir immer wieder ein großes Missverständnis: ADHS ist viel mehr als nur „Zappelphilippsyndrom“.
Wenn du dich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigst, wirst du merken – hier gibt es mehr Nuancen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Nicht alles, was als Zerstreutheit, Vergesslichkeit oder Reizbarkeit gilt, ist ADHS. Gleichzeitig gilt: Wer die Mechanismen versteht, kann gezielt unterstützen und typische Stolperfallen im Alltag vermeiden.
Bist du Heilpraktiker oder Therapeut?
Mit StaySana bekommst du mehr Sichtbarkeit und Tools für eine reibungslose Verwaltung deiner Selbstständigkeit. DSGVO-konform, sicher & modern.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist ADHS wirklich?
- Wie erkennst du ADHS bei Erwachsenen?
- Hilfen und praktische Strategien: Was unterstützt im Alltag?
- Fazit
- Wichtiger Hinweis
Was ist ADHS wirklich?
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Der Begriff erzeugt oft Bilder von überdrehten Kindern, doch das ist ein Klischee. In meiner Praxis begegne ich regelmäßig Erwachsenen mit ADHS, bei denen Hyperaktivität kaum auffällt – dafür sind Konzentrationsprobleme, schnelle Stimmungswechsel oder Schwierigkeiten beim Organisieren dominant.
Ein Detail, das viele unterschätzen: ADHS ist kein „Erziehungsproblem“ und auch keine Charakterfrage. Es handelt sich um eine neurobiologische Besonderheit im Gehirn. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN, 2022) beeinflusst ADHS vor allem die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin – beides Substanzen, die Aufmerksamkeit, Motivation und Impulskontrolle steuern.
Das Interessante dabei: Die Symptome hängen stark vom Lebensalter, den Lebensumständen und eigenen Kompensationsstrategien ab. Manche bemerken ihre ADHS erst nach einem Jobwechsel oder bei starker Belastung – vorher war sie gut „versteckt“. Therapeuten berichten übereinstimmend: ADHS sieht bei jeder Person etwas anders aus.
Hier wird’s komplex: ADHS ist keine eindeutige Diagnose wie ein gebrochenes Bein. Es gibt verschiedene Typen – vor allem der vorwiegend unaufmerksame Typ, der vorwiegend hyperaktive/impulsive Typ und der gemischte Typ. Die Symptome können sich im Alltag überlagern und wechseln. Deshalb gibt es keine „typische ADHS-Persönlichkeit“.
Was viele nicht wissen: ADHS bleibt in etwa 50-60% der Fälle bis ins Erwachsenenalter bestehen, oft verändert sich jedoch das Erscheinungsbild. Laut Robert Koch-Institut (2023) schätzen Experten die Prävalenz bei Erwachsenen auf etwa 2-4%.
Wie erkennst du ADHS bei Erwachsenen?
Vielleicht hast du noch nicht viel darüber gehört, dass ADHS im Erwachsenenleben meist viel subtiler wirkt als bei Kindern. Die klassischen Anzeichen – wie ständiges Zappeln oder lautstarke Impulsivität – sind selten. Wer ADHS hat, bekommt häufig Rückmeldungen wie „Du bist chaotisch“, „Dir fehlt Struktur“, oder „Du bist oft woanders mit den Gedanken“.
Hier ein praktischer Punkt aus der Beratung: Viele Erwachsene mit ADHS erledigen Aufgaben oft unter extremem Druck – „Last-Minute-Antrieb“ ist typisch. Aber: Dahinter steckt kein Unwille, sondern eine neurologisch bedingte Schwierigkeit, Motivation und Aufmerksamkeit dauerhaft zu bündeln. Das ist mit „normale Vergesslichkeit“ nicht zu vergleichen.
Der entscheidende Punkt: ADHS äußert sich bei Erwachsenen häufig in diesen Bereichen:
- Organisation: Schwierigkeiten, Alltag und Arbeit zu strukturieren, ständige Suche nach Unterlagen, Verpassen von Terminen.
- Motivation: Aufgaben werden oft aufgeschoben oder wirken überwältigend, selbst bei kleinen Tätigkeiten.
- Emotionale Regulation: Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, geringe Frustrationstoleranz.
- Impulsivität: Spontane Entscheidungen (auch im Gespräch), Schnelle Themenwechsel, Schwierigkeiten beim Zuhören.
- Geringe Selbstkontrolle: Schnell abgelenkt, „Gedanken springen“, Schwierigkeiten, bei einer Sache zu bleiben.
Ein häufiger Irrtum ist: Viele glauben, man müsse alle Symptome ausgeprägt erleben, um ADHS zu haben. In der Praxis zeigt sich: Schon einzelne, aber dauerhafte Schwierigkeiten können den Alltag massiv erschweren. Auch die Dosis macht den Unterschied – leichte Ausprägungen werden schnell als „Eigenheit“ abgetan.
Das Interessante in der Diagnostik: Die Übergänge zu anderen Störungen sind oft fließend. Depression, Angststörungen oder Suchterkrankungen kommen als Begleiter vor – manchmal überdeckt das ADHS sogar andere Themen. Umso wichtiger ist eine fachgerechte Abklärung.
Wie läuft die Diagnose ab?
Falls das neu für dich ist: Eine ADHS-Diagnose beruht nie auf einem Schnelltest oder ausschließlich auf Fragebögen. Im professionellen Setting werden Interviews, Tests, Fremdbeobachtungen und die gesamte Lebensgeschichte einbezogen. Denn kurzfristige Stressphasen oder Überforderung können ähnliche Symptome verursachen – das muss sauber getrennt werden.
Laut der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (2022) empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen: Erst ein ausführliches Gespräch, dann gezielte Tests wie die Wender Utah Rating Scale oder die DIVA. Was Therapeuten immer wieder betonen: Der Ausschluss anderer Erkrankungen ist entscheidend.
Hilfen und praktische Strategien: Was unterstützt im Alltag?
ADHS ist im Alltag oft eine Herausforderung – das wissen alle, die damit zu tun haben. Doch es gibt viele unterstützende Ansätze, die helfen können, Struktur und Wohlbefinden zu fördern. In meiner beruflichen Praxis zeigt sich besonders: Kleine Anpassungen bringen oft mehr spürbaren Nutzen als große, radikale Veränderungen.
Was wirklich hilft, ist eine Kombination aus mehreren Maßnahmen. Einzelne Methoden reichen meist nicht aus und wirken nur kurzfristig. Hier ein paar Strategien, die sich bewährt haben:
- Externe Hilfsmittel nutzen: Digitale Kalender mit Erinnerungsfunktion, Checklisten, visuelle Zeitpläne, feste Ablageorte – alles, was die Planung und das Gedächtnis entlastet. Ein Detail, das häufig den Unterschied macht: Die Erinnerung sollte immer auf mehreren Wegen erfolgen (z.B. visuell + akustisch).
- Pausen und Selbstkontrolle trainieren: Wer zu Impulsivität neigt, profitiert davon, vor Entscheidungen kurz innezuhalten – eine einfache Atemübung kann helfen, den „Reflex“ zu entschleunigen.
- Kleine Schritte planen: Aufgaben in Teilbereiche zerlegen, Prioritäten setzen, Zwischenziele formulieren. Das Ziel: Der Berg wird kleiner, die Motivation bleibt erhalten.
- Bewegungsphasen einbauen: Schon wenige Minuten gezielte Bewegung – etwa ein Spaziergang um den Block – können die Aufmerksamkeit und Stimmung deutlich steigern. Eine Meta-Analyse von 2021 (Deutsche Sporthochschule Köln) zeigt, dass regelmäßige Aktivität die Impulsregulation auch bei ADHS unterstützt.
- Feste Routinen schaffen: Morgens und abends immer das Gleiche (z.B. Taschen-Check, To-do-Liste) automatisieren Abläufe und verringern Stress.
- Offen umgehen: Klar kommunizieren, wo Schwierigkeiten bestehen. Das reduziert Missverständnisse im Freundes-, Arbeits- und Familienkreis.
Was viele nicht wissen: Ernährung spielt bei ADHS eine begleitende Rolle, ist aber kein Hauptfaktor. Manche berichten über positive Effekte bei regelmäßigen (und eiweißreichen) Mahlzeiten, aber das ist individuell unterschiedlich. Noch umstritten ist der Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln – hier gehen die Meinungen auseinander und gute Studien sind rar (DGPPN 2023).
Besonders wichtig: Die professionelle Unterstützung durch Therapeuten, Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen. Diese Angebote können die Überforderung auffangen und geben oft praxisnahe Tipps jenseits von Theorie. In meiner Erfahrung zeigt sich, dass sich viele erst nach Jahren der Selbsthilfe professionelle Begleitung suchen.
Medikamente: Was gibt es zu beachten?
Medikamente spielen bei schwer ausgeprägtem ADHS häufig eine unterstützende Rolle. Hier gilt absolute Zurückhaltung: Rezeptpflichtige Medikamente wie Methylphenidat oder Atomoxetin werden ausschließlich von Fachärzt:innen verschrieben und individuell angepasst – pauschale Empfehlungen sind unseriös und laut HWG nicht zulässig. Was ich in der Praxis beobachte: Medikamente allein sind selten die Lösung, sondern werden meist als Teil eines Gesamtkonzepts genutzt.
Wichtig zu wissen: Auch begleitende Therapien wie Verhaltenstherapie, Coaching oder Neurofeedback können laut der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (2023) die Selbststeuerung fördern. Das funktioniert aber nicht bei jedem gleich gut – hier zählt die individuelle Passung.
Ein häufiger Fehler, den ich beobachte: Zu schnell zu viel auf einmal ändern zu wollen. ADHS ist ein Marathon – mit kleinen, nachhaltigen Schritten kommst du weiter.
Fazit
ADHS ist komplex, vielschichtig und zeigt sich bei jedem Menschen anders. Was ich immer wieder beobachte: Der Mix aus passgenauen Alltagshilfen, offenem Umgang und professioneller Begleitung macht langfristig den größten Unterschied. Ein einzelner „Trick“ reicht meist nicht – was hilft, ist das Zusammenspiel. Bleib neugierig, probiere aus, was dir wirklich hilft und scheue dich nicht, Unterstützung zu suchen.
Tipp: Auf StaySana findest du weitere Informationen und passende Expert:innen, die dich individuell begleiten können.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Die Inhalte dieses Artikels stellen keine Heilversprechen dar und sind nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung gedacht.
Weitere Artikel, die spannend für dich sein könnten

Brainlog®: Wirkung, Anwendungsbereiche und praktische Tipps
Was bringt Brainlog®? Erfahre Wirkung, Anwendungsmöglichkeiten und hilfreiche Tipps zur Methode. Professionelle Einordnung und Antworten auf häufige Fragen.
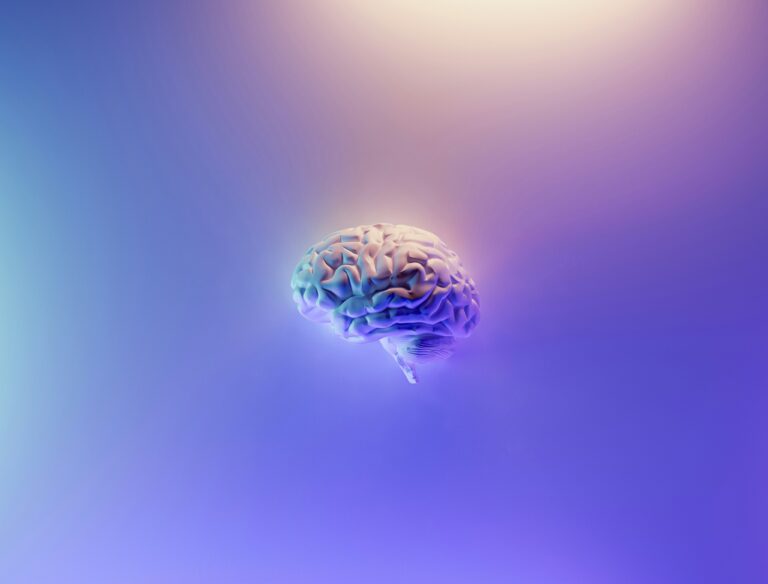
Brain Gym: Wirkung, Anwendung und praktische Tipps für den Alltag
Brain Gym erklärt: Wie die Übungen funktionieren, wann sie sinnvoll sind und wie du sie korrekt im Alltag einsetzt. Mit praktischen Expertentipps.

Bowtech®: Wirkung, Anwendung & praktische Tipps professionell erklärt
Bowtech® – Sanfte manuelle Methode zur Unterstützung von Wohlbefinden und Selbstregulation. Erfahre Wirkweise, Anwendungsfelder & Expertentipps.
