
Arbeit am Tonfeld (Tonfeldtherapie): Wirkung, Anwendung und was du wissen solltest
Wer sich zum ersten Mal mit Arbeit am Tonfeld oder Tonfeldtherapie beschäftigt, fragt sich oft: Was genau passiert dabei eigentlich? Und warum wird dieser Ansatz seit Jahrzehnten so häufig in Begleitung und Therapie genutzt, besonders wenn Worte nicht (mehr) alles ausdrücken können?
Die Erfahrung zeigt, dass Tonfeldtherapie weit über das “kreative Gestalten mit Ton” hinausgeht. Hier steht nicht das Kunstwerk im Vordergrund, sondern der dialogische Prozess zwischen den Händen, dem Ton und den zugrundeliegenden Lebensthemen. Was viele nicht wissen: Gerade in der Arbeit mit Erwachsenen kann diese Form der Therapie überraschend tiefgreifende Impulse geben – ohne Zwang, ohne Leistungsdruck, aber mit erstaunlicher Wirkung, die oft erst in der Nachbetrachtung richtig verstanden wird.
Bist du Heilpraktiker oder Therapeut?
Mit StaySana bekommst du mehr Sichtbarkeit und Tools für eine reibungslose Verwaltung deiner Selbstständigkeit. DSGVO-konform, sicher & modern.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Arbeit am Tonfeld (Tonfeldtherapie)?
- Wie läuft eine Tonfeldtherapie ab? Praktische Einblicke
- Wirkung und Anwendungsbereiche: Wann ist Arbeit am Tonfeld sinnvoll?
- Fragen aus der Praxis: Was du zur Tonfeldtherapie wissen solltest
- Fazit
- Wichtiger Hinweis
Was ist Arbeit am Tonfeld (Tonfeldtherapie)?
Arbeit am Tonfeld – auch bekannt als Tonfeldtherapie – ist ein von Heinz Deuser entwickeltes Verfahren, das ursprünglich aus der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Kindern stammt. Inzwischen wird diese Methode jedoch zunehmend auch in der Begleitung von Erwachsenen und Jugendlichen eingesetzt.
Im Mittelpunkt steht die beziehungsorientierte Erfahrung mit Ton. Anders als beim klassischen Töpfern steht nicht das Endprodukt, sondern der prozesshafte Umgang mit dem Material im Vordergrund. Die Hände tauchen in ein Tonfeld – eine weiche, etwa ein bis zwei Zentimeter starke Schicht Ton – und beginnen, sich frei zu bewegen. Das Interessante dabei: Schon diese einfachen, scheinbar spontanen Bewegungen spiegeln oft tieferliegende Themen wider, etwa Bindung, Abgrenzung oder das Bedürfnis nach Halt.
Therapeut:innen berichten übereinstimmend: Die Arbeit am Tonfeld ist ein nonverbaler Zugang zu inneren Prozessen. Das heißt, du musst (und sollst) nicht über alles sprechen – dein Körper, vor allem deine Hände, übernehmen gewissermaßen die “Sprache”. Deswegen eignet sich das Verfahren besonders dann, wenn Worte fehlen, Gefühle schwer greifbar sind oder klassische Gesprächstherapien an ihre Grenzen stoßen.
Laut Deutscher Gesellschaft für Arbeit am Tonfeld (2023) wird dieses Vorgehen heute in psychosozialen, pädagogischen und therapeutischen Kontexten genutzt – von der Entwicklungsförderung bei Kindern über die Begleitung in Krisenzeiten bis hin zur Arbeit mit Erwachsenen bei Themen wie Stress, Burnout oder Persönlichkeitsentwicklung.
Wie läuft eine Tonfeldtherapie ab? Praktische Einblicke
Ein häufiger Irrtum ist, dass Arbeit am Tonfeld ausschließlich für Kinder sei oder nur dann Sinn macht, wenn “gestaltet” werden soll. Tatsächlich geht es nicht um künstlerische Ergebnisse, sondern darum, wie du – im Zusammenspiel mit dem Ton – deinen eigenen Impulsen nachspüren kannst.
Typischer Ablauf einer Sitzung:
- Du setzt dich vor das Tonfeld – meist eine flache Holzschale, ausgelegt mit einem dicken, feuchten Tonfladen.
- Die Therapeut:in lädt dich ein, die Hände schonend einzutauchen und zu erkunden, ohne Vorgabe, ohne Ziel.
- Bewegungsmuster, die in den Händen entstehen, werden meist ganz nebenbei sichtbar. Mal sind sie wild, mal zögerlich, manchmal erstaunlich rhythmisch oder zurückhaltend.
- Die Fachperson bleibt präsent, greift aber nur unterstützend ein, wenn nötig. Vieles wird in achtsamen Pausen begleitet, manchmal mit kurzen Fragen oder Spiegelungen (“Wie fühlt sich die Stelle an?”).
- Wenn du magst, wird am Ende der Sitzung gemeinsam auf das Erlebte geblickt – was hat sich verändert, gab es Überraschungen, welche Körperempfindungen waren spürbar?
Was ich wiederholt beobachte: Je weniger Kontrolle, Bewertung oder Vorgaben entstehen, desto freier können sich die eigenen Ressourcen und Selbstheilungskräfte zeigen. Für viele ist das ungewohnt – und genau darin liegt oft das Entwicklungspotenzial.
Praktischer Tipp: Die Kleidung sollte bequem und nicht zu schade für Tonstriemen sein. Am besten vorher die Hände gut eincremen, denn Ton kann die Haut leicht austrocknen, gerade bei sensibler Haut.
Wirkung und Anwendungsbereiche: Wann ist Arbeit am Tonfeld sinnvoll?
Wirkung und Anwendungsbereiche der Tonfeldtherapie werden immer wieder diskutiert – pauschale Aussagen sind dabei wenig hilfreich. Aus der therapeutischen Arbeit zeigt sich eine ganze Bandbreite möglicher Effekte:
- Selbstwahrnehmung stärken: Das intensive Spüren von Druck, Temperatur und Widerstand fördert die Präsenz im eigenen Körper. Was viele nicht wissen: Sensorische Erfahrungen können innere Zustände oft direkter erfahrbar machen als Gespräche.
- Emotionaler Zugang: Gerade bei festgefahrenen Gefühlen oder “Leere” berichten viele von einer überraschenden Lebendigkeit beim Arbeiten mit Ton.
- Förderung von Beziehungs- und Bindungserfahrungen: Im Tonfeld spiegeln sich Aspekte wie Kontakt, Rückzug oder Grenzsetzung oft deutlich wider. Das kann helfen, Muster und Bedürfnisse besser zu verstehen (vgl. Deuser, 2020).
- Stress abbauen, Resilienz stärken: Die haptischen Reize und das konzentrierte, absichtslose Tun aktivieren nachweislich das parasympathische Nervensystem – ein Kontrapunkt zu anhaltendem Stress (Küster et al., 2021).
Häufige Einsatzfelder sind laut Deutscher Gesellschaft für Arbeit am Tonfeld (2023):
- Begleitung bei Entwicklungsverzögerungen (bei Kindern und Jugendlichen)
- Unterstützung in herausfordernden Lebensphasen (z. B. Trauer, Verlust, Neuanfang)
- Stärkung psychosomatischer Ressourcen bei Stress, Burnout, psychosozialen Belastungen
- Präventiv zur Persönlichkeitsentwicklung, z. B. in Coaching-Settings
Entscheidend: Die Wirkung der Arbeit am Tonfeld ist sehr individuell. Manche spüren eine sofortige Veränderung, bei anderen entwickelt sich der “innere Prozess” schleichend über Wochen. Was sich bewährt hat: Geduld und Offenheit – Druck blockiert den Zugang zu den eigenen Themen eher, als dass er hilft.
Fragen aus der Praxis: Was du zur Tonfeldtherapie wissen solltest
Für wen ist Arbeit am Tonfeld geeignet?
Obwohl das Verfahren ursprünglich für Kinder entwickelt wurde, hat es sich in vielen Altersgruppen bewährt. Besonders hilfreich ist es häufig, wenn verbale Zugänge an ihre Grenzen kommen – z. B. bei Überforderung, Unruhe, innerer Leere oder auch bei psychosomatischen Beschwerden. Auch Erwachsene profitieren, denn Tonfeldarbeit kann neue Zugänge zu alten Mustern, Gefühlen und Ressourcen schaffen. Allerdings: Bei schweren Traumatisierungen sollte die Anwendung nur von erfahrenen Fachkräften erfolgen.
Wie oft sollte man an einer Tonfeldtherapie teilnehmen?
Eine pauschale “Empfehlung” gibt es nicht – das richtige Tempo hängt stark von der Person und dem Prozess ab. Häufig bewährt sich ein Rhythmus von 1x pro Woche zu Beginn, mit der Möglichkeit zur Anpassung. Wesentlicher als die Frequenz ist aus Sicht vieler Therapeuten die Regelmäßigkeit.
Was kostet Tonfeldtherapie und wird sie übernommen?
Die Kosten variieren je nach Qualifikation der Therapeut:in und Region. In der Regel handelt es sich um eine Selbstzahlerleistung; einzelne private Zusatzversicherungen übernehmen manchmal einen Teil, gesetzliche Kassen üblicherweise nicht. Manche Beratungsstellen oder pädagogische Einrichtungen bieten das Verfahren als Teil ihres Angebots an.
Wie finde ich eine qualifizierte Fachperson für Arbeit am Tonfeld?
Achte bei der Auswahl auf zertifizierte Weiterbildungen, etwa bei der Deutschen Gesellschaft für Arbeit am Tonfeld. Qualifizierte Anbieter findest du häufig in psychosozialen Beratungsstellen, bei Ergotherapeut:innen mit Zusatzqualifikation oder in freien Praxen. Ein Kennenlerngespräch hilft, herauszufinden, ob die Chemie stimmt – gerade weil Arbeit am Tonfeld ein sensibler, vertrauensvoller Prozess ist.
Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen?
Schwere Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Allerdings kommen in der Tonfeldtherapie gelegentlich unerwartete Gefühle an die Oberfläche. Bei bestehenden Traumafolgestörungen sollte das Verfahren deswegen nur in besonders geschütztem Rahmen und durch erfahrene Therapeut:innen durchgeführt werden. Offenheit und Freiwilligkeit sind zentrale Voraussetzungen.
Was ist der Unterschied zu anderen kreativen Verfahren?
Der entscheidende Punkt: Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen – wie klassischer Kunsttherapie oder Ergotherapie – steht bei der Arbeit am Tonfeld das unmittelbare, dialogische Spüren mit dem Material im Mittelpunkt, weniger das schöpferische Ergebnis. Dieser Fokus auf prozessorientiertes, beziehungsgeleitetes Tun macht die Methode unverwechselbar.
Fazit
Arbeit am Tonfeld beziehungsweise Tonfeldtherapie kann einen überraschend tiefen Zugang zu inneren Ressourcen, Mustern und Gefühlen eröffnen – gerade dann, wenn Worte allein nicht weiterführen. Die Methode zeichnet sich durch ihre Umgebungssensibilität und Flexibilität aus und wird von vielen Therapeuten als ergänzende, nicht ersetzende Maßnahme geschätzt. Wer den Mut aufbringt, sich auf das scheinbar Einfache einzulassen, kann profitieren – allerdings ohne Garantie, sondern mit Offenheit für persönliche (Entwicklungs-)Wege.
Tipp: Auf StaySana findest du weitere Informationen und passende Expert:innen, die dich individuell begleiten können.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Die Inhalte dieses Artikels stellen keine Heilversprechen dar und sind nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung gedacht.
Weitere Artikel, die spannend für dich sein könnten

Brainlog®: Wirkung, Anwendungsbereiche und praktische Tipps
Was bringt Brainlog®? Erfahre Wirkung, Anwendungsmöglichkeiten und hilfreiche Tipps zur Methode. Professionelle Einordnung und Antworten auf häufige Fragen.
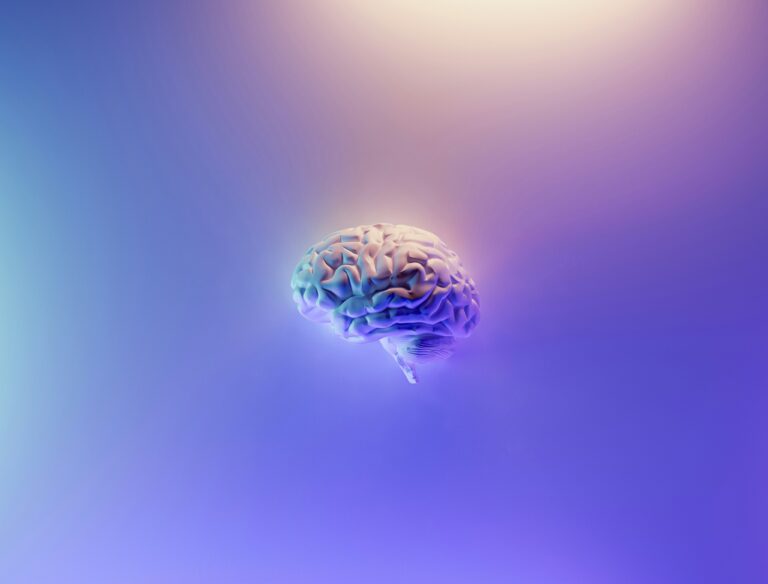
Brain Gym: Wirkung, Anwendung und praktische Tipps für den Alltag
Brain Gym erklärt: Wie die Übungen funktionieren, wann sie sinnvoll sind und wie du sie korrekt im Alltag einsetzt. Mit praktischen Expertentipps.

Bowtech®: Wirkung, Anwendung & praktische Tipps professionell erklärt
Bowtech® – Sanfte manuelle Methode zur Unterstützung von Wohlbefinden und Selbstregulation. Erfahre Wirkweise, Anwendungsfelder & Expertentipps.
