
Tiergestützte Therapie (Animal Assisted Therapy): Wirkung, Anwendung und Praxistipps
Tiere im therapeutischen Kontext einzusetzen – das klingt für viele erstmal nach etwas Besonderem. Doch was genau steckt hinter dem Begriff „tiergestützte Therapie“ (Animal Assisted Therapy) und warum findet sie zunehmend ihren Platz in der modernen Gesundheitsversorgung?
Wer sich zum ersten Mal mit diesem Ansatz beschäftigt, merkt schnell: Tiere bringen nicht einfach nur „gute Laune“ ins Therapiezimmer. Die Effekte sind weitreichender – und es gibt klare Regeln, wann und wie tiergestützte Therapie sinnvoll eingesetzt werden kann. Im Folgenden findest du einen fundierten Überblick darüber, wie Tiere in verschiedenen Settings unterstützen können, was sich in der Praxis bewährt hat und worauf du bei diesem besonderen Therapieansatz achten solltest.
Bist du Heilpraktiker oder Therapeut?
Mit StaySana bekommst du mehr Sichtbarkeit und Tools für eine reibungslose Verwaltung deiner Selbstständigkeit. DSGVO-konform, sicher & modern.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen: Was versteht man unter tiergestützter Therapie?
- Wie wirkt tiergestützte Therapie? Mechanismen und Besonderheiten
- Anwendungsbereiche: Wann kann tiergestützte Therapie sinnvoll sein?
- Worauf solltest du achten? Praktische Tipps und Hinweise
- Fazit
- Wichtiger Hinweis
Grundlagen: Was versteht man unter tiergestützter Therapie?
Der Begriff „tiergestützte Therapie“ umfasst therapeutische Ansätze, bei denen gezielt Tiere eingesetzt werden, um bestehende Behandlungsprozesse zu unterstützen. Hierbei steht nicht das Tier im Mittelpunkt, sondern der Mensch – genauer gesagt: Wie kann der Kontakt mit Tieren einen therapeutischen Mehrwert bieten?
Es gibt unterschiedliche Formen: Während die tiergestützte Therapie (Animal Assisted Therapy, kurz AAT) auf strukturierte, zielgerichtete Sitzungen im therapeutischen Kontext abzielt, unterscheiden Fachleute außerdem noch tiergestützte Aktivitäten (Animal Assisted Activities, AAA) – zum Beispiel den Hundebesuch im Seniorenheim – und tiergestützte Pädagogik im schulischen Umfeld. Für die medizinische Versorgung spielen vor allem die fundiert geplanten Therapieangebote eine Rolle, welche auch Teil professioneller Behandlungskonzepte sein können.
Häufig kommen Hunde zum Einsatz, aber auch Pferde, Katzen, Kaninchen oder – weniger verbreitet – Alpakas oder Meerschweinchen. Entscheidend ist dabei: Nur speziell ausgebildete Tiere und Fachkräfte dürfen solche Interventionen durchführen (vgl. Deutscher Bundesverband für tiergestützte Interventionen, 2023).
Wie wirkt tiergestützte Therapie? Mechanismen und Besonderheiten
Was viele nicht wissen: Die Wirkung tiergestützter Therapie ist weit mehr als ein bisschen „Streicheln tut gut“. Es gibt mehrere Mechanismen, die immer wieder beobachtet werden – sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene.
Physiologisch wirkt der Kontakt zu Tieren oft entspannend: Blutdruck und Herzfrequenz sinken messbar, das Stresshormon Cortisol kann reduziert werden (Deutsche Gesellschaft für Tiergestützte Therapie, 2022). Das erklärt auch, warum Menschen mit Angststörungen oder chronischem Stress davon profitieren können.
Auf psychischer Ebene zeigt sich in der therapeutischen Arbeit häufig ein „Türöffner-Effekt“. Viele Menschen können sich mit einem Tier an ihrer Seite leichter öffnen, Empathie und Vertrauen wachsen oft schneller, als es allein im Gespräch möglich ist. Ein wichtiger Punkt: Tiere bewerten nicht, sie begegnen Menschen vorbehaltlos – das realisieren Patient:innen intuitiv und es kann therapeutische Blockaden lösen.
Ein Detail, das häufig übersehen wird: Besonders bei Kindern oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen helfen Tiere, Aufmerksamkeit und Motivation überhaupt erst zu ermöglichen. Die Therapie wird dadurch zugänglicher und häufig nachhaltiger.
Aber auch die Grenzen werden deutlich: Tiergestützte Therapie ist kein Ersatz für bewährte medizinisch-therapeutische Verfahren – sie kann aber begleitend sehr wertvoll sein.
Anwendungsbereiche: Wann kann tiergestützte Therapie sinnvoll sein?
Die Einsatzmöglichkeiten von Animal Assisted Therapy sind breit gefächert. Besonders häufig wird sie unterstützend bei folgenden Problemen und Zielgruppen angewendet:
- Psychische Erkrankungen: Zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Traumata oder Burnout.
- Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern: ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, emotionale Störungen.
- Neurologische Erkrankungen: MS, Demenz, Schlaganfall-Nachsorge.
- Rehabilitation nach körperlichen Erkrankungen oder Unfällen
- Förderung sozialer Kompetenzen: In Schulen, Fördereinrichtungen, Gruppenangeboten.
Therapeuten berichten übereinstimmend, dass gerade bei Menschen, die schwer Zugang zu klassischen Therapieformen finden, die tiergestützte Therapie neue Möglichkeiten eröffnet. Das gilt beispielsweise für ältere Menschen mit Demenz: Hier kann die Erinnerung an frühere positive Tiererfahrungen aktiviert werden, was Lebensqualität und Kommunikation spürbar verbessern kann.
Aber auch Erwachsene im Arbeitsalltag berichten nach tiergestützter Begleitung häufiger von mehr Entspannung und besserer Regulation von Stress. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Wirkung individuell sehr unterschiedlich entfalten kann – Erwartungen sollten deshalb realistisch bleiben.
Tiergestützte Interventionen können zudem die Selbstwirksamkeit stärken, da Klienten durch den Umgang mit dem Tier Verantwortung übernehmen und unmittelbare Rückmeldung erhalten. Das sorgt für kleine Erfolgserlebnisse, die im therapeutischen Prozess oft den entscheidenden Unterschied machen.
Worauf solltest du achten? Praktische Tipps und Hinweise
Die Entscheidung, ob tiergestützte Therapie für dich infrage kommt, sollte sorgfältig getroffen werden. Hier ein paar Punkte, die sich bewährt haben:
- Qualifikation ist entscheidend: Achte darauf, dass die Fachkraft eine anerkannte Ausbildung hat – und das Tier ebenfalls gezielt für therapeutische Arbeit geschult wurde. Gerade in Deutschland gibt es strenge Standards und regelmäßige Kontrollen.
- Individuelle Passung: Nicht jedes Tier passt zu jedem Menschen. Allergien, Ängste oder kulturelle Hintergründe sollten respektiert werden. Der Erstkontakt sollte immer behutsam gestaltet werden.
- Sicherheit geht vor: Hygiene und Sicherheit sind oberste Pflicht – sowohl für dich als auch für das Tier. Ein verantwortungsvoller Umgang schließt regelmäßige tierärztliche Kontrollen mit ein.
- Realistische Erwartungen: Tiergestützte Therapie kann unterstützen, ist aber niemals eine Garantie für schnellen Erfolg. Oft sind es kleine Schritte, die sich im Alltag bemerkbar machen.
- Regelmäßigkeit zählt: Kontinuität in den Treffen mit dem Tier führt zu besseren Ergebnissen als einmalige Begegnungen. Das gilt besonders in der Arbeit mit Kindern und Menschen mit chronischen Erkrankungen.
Ein häufiger Irrtum ist, dass „jedes Haustier“ therapeutisch einsetzbar sei. Das Gegenteil ist der Fall: Nur speziell ausgebildete Tiere eignen sich, spontaner Einsatz kann Risiken bergen – für Mensch und Tier.
Was sich bewährt hat: Vor dem Start das Ziel klar definieren. Was soll erreicht werden? Mehr Motivation? Abbau von Ängsten? Die Zielorientierung erhöht die Effektivität tiergestützter Interventionen deutlich.
Hier wird’s komplex: Manchmal zeigen sich erste Veränderungen erst nach mehreren Wochen. Es lohnt sich, Geduld mitzubringen und kleine Fortschritte wertzuschätzen.
Falls du allergisch bist oder unsicher wegen Vorerkrankungen, gilt: Vorab immer medizinischen Rat einholen. Gerade bei Immunschwäche oder schweren Lungenerkrankungen kann der Kontakt mit Tieren ein Risiko darstellen.
Fazit
Tiergestützte Therapie (Animal Assisted Therapy) ist eine bereichernde Ergänzung zu klassischen Therapieformen – kein Wundermittel, aber ein sinnvoller, unterstützender Ansatz mit viel Potenzial, gerade wenn es um Motivation, emotionale Öffnung und Förderung sozialer Kompetenzen geht. Entscheidend sind professionelle Begleitung, klare Zielsetzung und ein bewusster, respektvoller Umgang mit dem Tier. Wer offen für neue Wege in der Therapie ist, entdeckt mit diesem Ansatz oft ungeahnte Ressourcen.
Tipp: Auf StaySana findest du weitere Informationen und passende Expert:innen, die dich individuell begleiten können.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Die Inhalte dieses Artikels stellen keine Heilversprechen dar und sind nicht zur Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung gedacht.
Weitere Artikel, die spannend für dich sein könnten

Brainlog®: Wirkung, Anwendungsbereiche und praktische Tipps
Was bringt Brainlog®? Erfahre Wirkung, Anwendungsmöglichkeiten und hilfreiche Tipps zur Methode. Professionelle Einordnung und Antworten auf häufige Fragen.
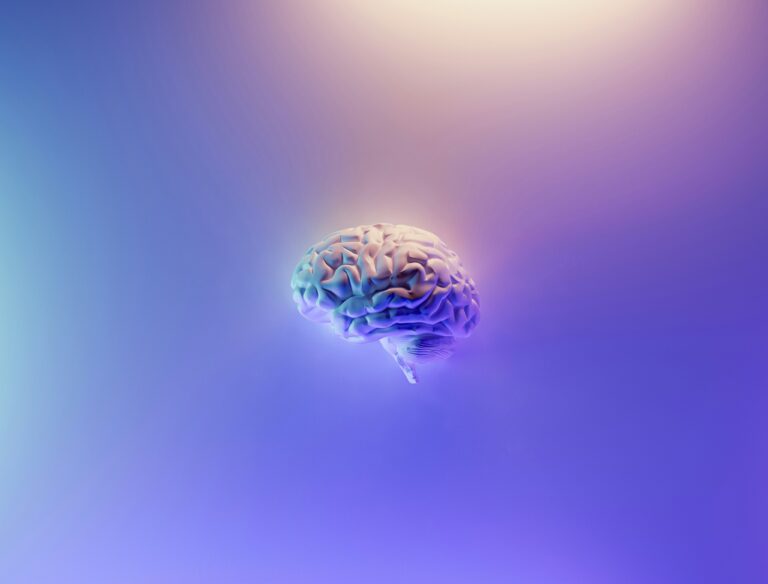
Brain Gym: Wirkung, Anwendung und praktische Tipps für den Alltag
Brain Gym erklärt: Wie die Übungen funktionieren, wann sie sinnvoll sind und wie du sie korrekt im Alltag einsetzt. Mit praktischen Expertentipps.

Bowtech®: Wirkung, Anwendung & praktische Tipps professionell erklärt
Bowtech® – Sanfte manuelle Methode zur Unterstützung von Wohlbefinden und Selbstregulation. Erfahre Wirkweise, Anwendungsfelder & Expertentipps.
